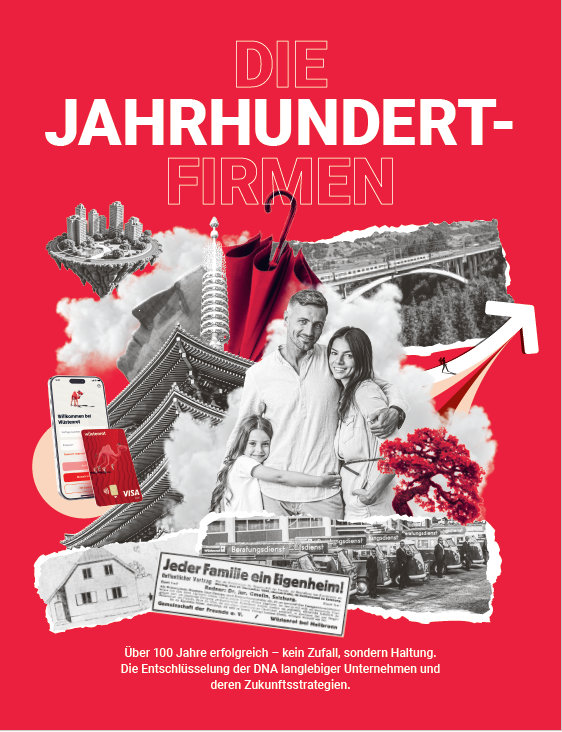Wie ein Unternehmen mit langer Tradition Innovation fördern kann, zeigen die Österreichischen Bundesbahnen: 1923 gegründet, ließen sie sich in ihrer Erfolgsgeschichte nicht aufhalten und trotzten Krisen, Naturkatastrophen und anderen Herausforderungen. Dabei blieben sie ihren Werten immer treu und sind heute wie damals verlässliche Partner sowie Vorreiter der nachhaltigen Mobilität.
Als im 19. Jahrhundert die ersten Züge der Kaiserlich-königlichen österreichischen Staatsbahn durch die Lande der Monarchie fuhren, revolutionierten sie nicht nur die Mobilität der Menschen, sondern auch den Gütertransport und damit die Wirtschaft.
Dann brach der erste Weltkrieg über Österreich herein, zerschlug die Monarchie und zerstörte große Teile der Infrastruktur. In diese Zeit fällt die Gründung der ÖBB als eigenständiges Unternehmen mit 113.000 Mitarbeiter:innen, 2.600 Dampflokomotiven und enormen Herausforderungen, die es zu meistern galt: Die Struktur war veraltet, das Unternehmen verschuldet und die Dampfloks verschlangen rund 2,2 Millionen Tonnen Kohle pro Jahr. Schnell musste das noch junge Unternehmen erfinderisch werden und startete das erste Elektrifizierungsprogramm.
Dass diese Kehrtwende gelang, zeigt sich heute – über 100 Jahre später: Aus der Eisenbahn mit qualmender Dampflok wurden die modernen Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) mit sauberem Antrieb aus grünem Strom, der Österreich pro Jahr mehr als vier Millionen Tonnen CO₂ einspart. Heute beschäftigen die ÖBB rund 45.000 Mitarbeiter:innen und somit weniger als die Hälfte der Mitarbeiter:innen als in den Anfängen. Auf der anderen Seite befördern sie mit mehr als einer halben Milliarde Fahrgäste so viele Menschen wie noch nie.
Eines zeigt der kurze Blick auf die lange Geschichte des größten Eisenbahnkonzerns Österreichs: Innovation und Transformation sind in der Tradition der ÖBB fest verankert. Sie sind wesentliche Faktoren für den langen Unternehmenserfolg. Welche das noch sind und wie die ÖBB mit Krisen umgeht, erzählt Silvia Angelo, Vorständin der ÖBB-Infrastruktur AG.
Wirtschaftlicher Erfolg ist vielschichtig und von zahlreichen Faktoren abhängig. Doch wenn ein Unternehmen 100 Jahre und mehr besteht, lohnt es sich, genauer hinzuschauen: Welche Strategien, Werte und Prinzipien tragen zu diesem außergewöhnlichen Erfolg bei?
Die 100-jährige Geschichte von Wüstenrot zeigt eindrucksvoll, dass nachhaltiges Wachstum vor allem durch Kundennähe, kontinuierliche Innovationskraft und ein verantwortungsbewusstes Produktangebot gelingt.
Im Rahmen unseres Jubiläums möchten wir deshalb gemeinsam mit anderen traditionsreichen Unternehmen aus Österreich und der ganzen Welt den Erfolgsfaktoren auf den Grund gehen. Diese Gespräche geben Einblicke in bewährte Erfolgsrezepte, die Generationen verbinden und den Herausforderungen der Zeit trotzen.
Ihr Unternehmen gibt es seit 102 Jahren. Was waren die großen Meilensteine und Wendepunkte der Firmengeschichte?
Als über 100-jähriges Unternehmen haben wir natürlich die verschiedenen Phasen der Historie durchlebt – die guten wie die schlechten. Zur Zeit unserer Gründung befand sich Österreich zwischen zwei Weltkriegen, die ÖBB waren vom ersten Weltkrieg hoch verschuldet und rund 40 Prozent der Infrastruktur war zerstört. Und zu dieser Zeit wurden wir ein eigener Wirtschaftskörper mit professionellem Management – das war revolutionär, aber auch herausfordernd.
In den 1960/70er-Jahren gewann das Auto an Stellenwert, das in der Bevölkerung als Symbol der Freiheit gefeiert wurde. Den ÖBB gelang es aber, die Bahn aus ihrem Dornröschenschlaf zu wecken und ihr Retro-Image in jenes eines modernen und effizienten Unternehmens zu verwandeln.
Heute ist das Bild wieder ein ganz anderes: Die Jugend ist gern mit der Bahn unterwegs, es ist wieder schick – nicht zuletzt aufgrund von Initiativen wie dem Jugendticket, dem Klimaticket oder den Nachtzügen. Leistbare Mobilität ist ein zentrales Thema, ebenso wie Nachhaltigkeit: Wir fahren zu 100 Prozent mit grünem Strom, den wir zu einem großen Teil selbst erzeugen. Als nachhaltiges Verkehrsmittel verpflichten wir uns selbst dazu.
Wie wird sich Ihrer Meinung nach Mobilität verändern?
Durch die Verbreitung der E-Mobilität werden die Menschen auch in Zukunft noch viel mit dem Auto unterwegs sein. Aber besonders in den Städten wird der öffentliche Raum anders genutzt werden als für den Individualverkehr, den Straßenbau und Parkplätze – nicht zuletzt durch die steigende Hitzebelastung. Bei dieser Entwicklung werden die öffentlichen Verkehrsmittel eine wichtige Rolle spielen.
Außerdem fokussieren sich junge Menschen nicht mehr nur auf ein Fortbewegungsmittel, sondern möchten sich einfach schnell fortbewegen – je nachdem, was gerade zur Verfügung steht und was ökologisch ist: ob ein E-Bike, ein Scooter, die U-Bahn oder die Bahn. Mobilität wird immer mehr zur „Commodity“.
Wie gehen die ÖBB mit Krisen und Herausforderungen um?
Allein in den letzten fünf Jahren waren nicht wenige Krisen dabei – wie beispielsweise die Corona-Pandemie, explodierende Energiepreise, die hohe Inflation, die Hochwasserkatastrophe auf der Weststrecke … Deshalb kann ich sagen: Wir können Krise.
Covid hat uns sehr getroffen. Plötzlich mussten wir uns fragen, wie wir damit umgehen, wenn niemand mehr mit dem Zug fährt. Wir hatten damals „Geisterzüge“ und einen sehr ausgedünnten Fahrplan. Es war nicht klar, ob und wie wir nach alldem wieder auf den Stand von 2019 kommen können. Umso überraschter waren wir, als die Menschen sehr schnell wieder zurückkamen und wir die Zahlen von 2019 sogar toppen konnten. Wir hätten gedacht, dass es länger dauern würde.
Wenn Sie an die Zukunft denken: Was sind aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen und wie wollen Sie darauf reagieren?
Der Schutz vor Naturkatastrophen wird die ÖBB in Zukunft noch mehr beschäftigen, denn durch unsere in der Landschaft liegende Infrastruktur sind wir für solche Ereignisse anfällig und angreifbar. Die Hochwasserkatastrophe im September 2024 hat nicht nur uns mit noch nie dagewesenen Regenmengen überrascht.
Naturereignisse werden immer extremer und in diesem Ausmaß gibt es keinen hundertprozentigen Schutz.
Welche Rolle spielt für Sie Innovation?
Die Rolle von Innovationen, Forschung und Entwicklung auf allen Gebieten kann man gar nicht überschätzen, denn ohne sie ist die Bahn von morgen nicht denkbar.
Um zukunftsfit zu sein, wollen wir unsere Leistungsfähigkeit bis 2040 verdoppeln – das fordert die Menschen und das Material in besonderem Maße. Hierbei ist die Digitalisierung sehr wichtig. Daneben müssen wir aber auch einen Generationswechsel inklusive Wissenstransfer managen, rund 40 Prozent der Belegschaft verlassen uns innerhalb weniger Jahre. Diesen Wandel nutzen wir auch für Weiterentwicklung, Innovationen, Digitalisierungsprojekte und mehr Vielfalt in der Belegschaft. Bei uns kann man an der Bahn von morgen mitarbeiten – ein großes Projekt, das mitentscheiden wird, wie unsere Zukunft und die Welt unserer Kinder aussehen wird.
Welche Bedeutung hat die eigene Unternehmensgeschichte für die Weiterentwicklung des Unternehmens? Gibt es Werte, Strategien oder Herangehensweisen, die Sie bis heute beibehalten haben?
In unserer Branche werden viele Traditionen hochgehalten und der Beruf zum Teil über Generationen weitergegeben. Bei uns wird man oft gefragt: „In der wievielten Generation bist du Eisenbahner:in?“ (lacht)
Für uns war und ist oberste Priorität, die Mobilität für Personen und Güter sicherzustellen – das ist essenziell für die soziale Teilhabe sowie die Wirtschaft. Das bedeutet: Durch Mobilität können Menschen ihren Job ausüben und sich mit anderen Menschen treffen. Und durch Mobilität können Güter befördert werden. Das nehmen wir sehr ernst.
Unsere wichtigsten Grundwerte sind daher Sicherheit und Pünktlichkeit: Sicherheit steht bei allem, was wir tun, an erster Stelle. Das war vor hundert Jahren so und wird sich niemals ändern.
Wie sieht in Ihrem Unternehmen das Zusammenspiel zwischen Tradition und Zukunftsausrichtung aus? Woran halten Sie fest und was wird erneuert?
Ein wichtiges Motto bei uns lautet „Wir vor ich“. Gerade in Krisenzeiten zeigte sich, wie wichtig Teamarbeit ist. Und Tradition kann hierfür sehr identitätsstiftend sein. Es ist wie eine gute Verwurzelung, die zusätzlich Kraft gibt, aber auf der anderen Seite auch nicht die Beweglichkeit einschränkt. Tradition kann einem auch das gute Gefühl geben, an einer größeren, generationenübergreifenden Sache zu arbeiten.
Was würden Sie Menschen raten, die heute ein Unternehmen gründen, um mindestens 100 Jahre erfolgreich zu sein?
Wichtig ist, immer sehr nahe an den Kundenwünschen und den Entwicklungen der Zeit zu sein. Denn wer als Unternehmen nicht mitgeht, kann schnell überholt werden und den Anschluss verpassen.
Wenn wir in unserer Entwicklung steckengeblieben wären, könnten wir heute nicht das Rückgrat der Mobilitätswende sein.
Mit dem Prinzip des sechsjährigen rollierenden Rahmenplans haben wir auch eine finanzielle Plattform, die Planungssicherheit bietet und um die uns andere Bahngesellschaften in Europa beneiden.
Was ist Ihrer Meinung nach das verbindende Element zwischen Unternehmen, die 100 Jahre oder länger bestehen?
Vielleicht haben viele dieser Unternehmen gemeinsam, dass sie ihrer DNA treu geblieben sind. Bei der Bahn war das immer umweltfreundliche Mobilität für Menschen und Güter. Der Schutz der Umwelt ist also in unserer ÖBB-DNA festgeschrieben und wir haben vor 100 Jahren E-Mobilität gelebt, als es diesen Begriff noch gar nicht gab.
Es gibt sicher viele individuelle Gründe bei allen Unternehmen, aber eine Gemeinsamkeit könnte sein: flexibel, mutig und innovativ auf aktuelle Rahmenbedingungen reagieren, um langfristig auf Kurs zu bleiben.
Unternehmen: Österreichische Bundesbahnen – ÖBB
Gegründet: 1923
Zentrale: Am Hauptbahnhof 2, 1100 Wien
Standorte: in ganz Österreich
Mitarbeiteranzahl: 42.600 & 2.000 Lehrlinge